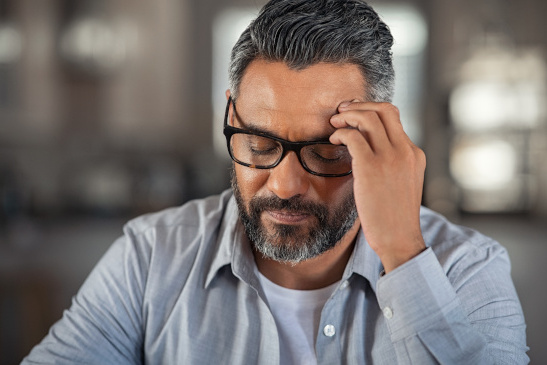Hochsensibilität
Inhaltsverzeichnis
Sensibilität: Was ist das?
Sensibilität ist die Fähigkeit eines Menschen, Reize auf verschiedene Weise aufzunehmen und zu verarbeiten. In der Medizin versteht man unter Sensibilität vor allem die Fähigkeit zur Wahrnehmung verschiedener Reize über Sinnesorgane bzw. das Nervensystem. Dazu zählen etwa:
- Berührungsreize,
- die Wahrnehmung von Temperatur oder Schmerz sowie
- das Spüren von Reizen innerer Organe oder der Muskulatur.
In der Psychologie spricht man in Bezug auf Sensibilität in erster Linie von Empfindsamkeit. Diese stellt eine Summe von Wahrnehmungen dar und kann Folgendes umfassen:
- Sinnesreize, d.h. Hören, Sehen, Schmecken, Riechen, Spüren,
- die Wahrnehmung von eigenen Gefühlen und Gedanken sowie
- Empfindungen im Umgang mit anderen Menschen – zum Beispiel Mitgefühl.
Die Fachwelt beschäftigt sich im Zusammenhang mit Hochsensibilität überwiegend mit psychologischen Aspekten. Sie geht davon aus, dass es unterschiedliche Ausprägungen der Sensibilität gibt: z.B. unterdurchschnittlich bzw. durchschnittlich sensibel oder hochsensibel. Es gibt Unterschiede, wie Menschen Umweltreize wahrnehmen und verarbeiten. Auf manche Menschen wirken sich Reizeinflüsse intensiver aus als auf andere.
Eine wesentliche Rolle für die Sensibilität in Bezug auf Persönlichkeit und Gefühle spielt das Temperament eines Menschen. Unter Temperament versteht man Eigenschaften eines Menschen, die unter anderem das Gefühlsleben, die Aufmerksamkeit und den Antrieb beeinflussen. Es ist ein recht stabiler Persönlichkeitsfaktor.
Hochsensibilität: Was ist das?
Der Ausdruck Hochsensibilität geht ursprünglich auf Forschungen der Psychologin Elaine N. Aron zurück. Hochsensibilität ist keine psychische Erkrankung. Laut Forschungen geht man von einer Neigung bzw. Veranlagung aus, Reize und Informationen stärker zu verarbeiten. Fachleute bezeichnen Menschen mit dieser Art der Verarbeitung mitunter als hochsensible Personen (HSP).
Wie kann man Hochsensibilität feststellen?
Um die Hochsensibilität psychologisch zu testen, wird meist die sogenannte HSPS-Skala verwendet. Die Abkürzung kommt aus dem Englischen für Highly Sensitive Person Scale. Für Kinder und Jugendliche entwickelten Fachleute eine eigene Skala, die Highly Sensitive Child scale – HSC. Testungen können zum Beispiel zur Abgrenzung von psychischen Erkrankungen – im Rahmen einer klinisch-psychologischen Diagnostik – stattfinden.
Woran forschen Fachleute zum Thema Hochsensibilität?
Laufende Forschungen beschäftigen sich mit unterschiedlichen Aspekten zum Thema Hochsensibilität, etwa zu psychischer Verletzlichkeit von hochsensiblen Menschen. Fachleute sind sich zu wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu nicht immer einig.
Welche Ursachen hat Hochsensibilität?
Derzeit gibt es noch keine wissenschaftlich eindeutig belegte Theorie, um die Ursachen von Hochsensibilität erklären zu können. Man nimmt an, dass eine genetische Veranlagung die Sensibilität erhöhen kann. Auch Erfahrungen während des Lebens könnten sich diesbezüglich auswirken und komplex mit genetischen Veranlagungen zusammenspielen. Ebenso wird weiter erforscht, welche Abläufe im Gehirn Einfluss in Bezug auf Hochsensibilität haben könnten.
Wie kann sich Hochsensibilität zeigen?
Hochsensibilität kann sich unter anderem in folgenden Eigenschaften bemerkbar machen:
- Stärkere Wahrnehmung von Details aus der Umwelt
- Intensivere Verarbeitung von Sinnesreizen
- Stärkere Gefühlsreaktionen
- Leichtere Überforderung durch äußere Reize
Betroffene haben mitunter den Eindruck, von Reizen überflutet zu sein – Sinnesreize und Gefühle. Das kann unter anderem auch zu schnellerer Erschöpfung und Überreizung führen. Sie benötigen meist mehr Rückzugsräume, um die Eindrücke zu verarbeiten und sich davon zu erholen.
Die Eigenschaften von vermehrter Sensibilität bzw. Hochsensibilität können jedoch auch Vorteile mit sich bringen. Zum Beispiel: frühes Erkennen von Konflikten oder eine genussvolle und intensive Wahrnehmung von Schönem.
Die Fachwelt geht davon aus, dass auch Kinder je nach Ausprägung ihrer Sensibilität empfänglicher gegenüber Reizen bzw. Umweltbedingungen sein können. Dabei könnten sensiblere Kinder stärker unter negativen Umweltbedingungen leiden, jedoch auch besonders für positive empfänglich sein.
Was kann im Umgang mit Hochsensibilität unterstützen?
Welche Maßnahmen bei Hochsensibilität unterstützen, ist derzeit Gegenstand der Forschung. Die Fachwelt geht davon aus, dass unter anderem Achtsamkeitsübungen hilfreich sein können. Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Achtsamkeit.
Auch der Austausch in einer Selbsthilfegruppe kann Unterstützung bieten. Die Österreichische Kompetenz- und Servicestelle für Selbsthilfe (ÖKUSS) bietet eine bundesweite Übersicht über Selbsthilfegruppen.
Eine Orientierungshilfe, woran Sie gute Gesundheitsinformationen erkennen, finden Sie auf der Österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz.
Anlaufstellen bei psychischen Problemen finden Sie unter Wenn die Psyche Hilfe braucht.
Die verwendete Literatur finden Sie im Quellenverzeichnis.
Letzte Aktualisierung: 15. Oktober 2025
Erstellt durch: Redaktion Gesundheitsportal
Expertenprüfung durch: Dr. Tobias Glück, Klinischer und Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut